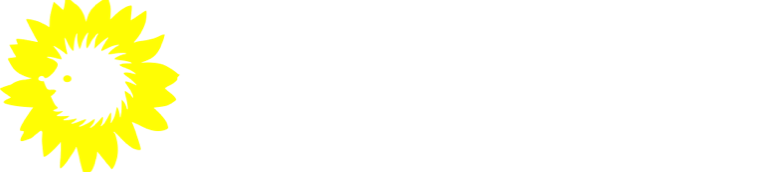Am 12. Juni 2025 habe ich zum dritten Bericht des unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten gesprochen. Dabei habe ich noch einmal herausgestellt: Der Polizeibeauftragte ist ein Erfolgsprojekt von Rot-Rot-Grün, welches durch das zuverlässige Bearbeiten von Beschwerden das Vertrauen der Berliner*innen in staatliche Behörden zurückgewinnen kann. Wenn das Handeln unserer Behörden unabhängig überprüft wird, werden im besten Fall strukturelle Probleme aufgedeckt, welche wir als Politik lösen können.
Plenarprotokoll 19/67
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist das dritte Berichtsjahr des unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten, und auch in diesem Jahr können wir wieder viel lernen, wenn wir uns die Fälle aus dem Bericht vor Augen führen.
Herr Dr. Oerke, zunächst einmal möchte ich Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, die sich um jeden einzelnen dieser Fälle kümmern, meinen Dank und auch den Dank meiner Fraktion aussprechen. Ihr Bericht zeigt in vielen Einzelfällen auf, wo die Stadt nicht funktioniert. Einzelfälle, das wissen wir, können auch manchmal Anstoß für strukturelle Verbesserungen sein. Gerade wir hier als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, als Vertreter der Menschen in Berlin sollten uns doch immer vor Augen führen: Wenn Menschen mit ihren Anliegen um Hilfe suchen, dann sollten wir uns zumindest ihrer annehmen, denn wo Bürger und Behörde aufeinanderclashen, lohnt es sich auch hinzuschauen. Umso besser eben, dass es auch Stellen gibt, die sich dessen ernsthaft und gewissenhaft annehmen. Jede Beschwerde verdient es, ernsthaft bearbeitet zu werden. Jede erfolgreiche Schlichtung kann Vertrauen in staatliches Handeln zurückgewinnen. Der Beauftragte ist dabei we- der Freund noch Feind, sondern neutraler Vermittler zwischen Bürgern und Bürgerinnen und Behörden. Das ist, was Ihre Arbeit so wichtig macht, für uns als Parlament, aber auch für die ganze Stadt. Blicken wir also auf das, was letztes Jahr in Berlin so los war: 784 Fälle, eine Steigerung um 83 Prozent. Im nächsten Jahr, habe ich gelesen, können es sogar über 1 000 Fälle werden. Was sagt uns das? – Wir sprechen ja bei Fallsteigerungen sonst sehr gern von Alarmsignalen.
Ich finde, das trifft es an dieser Stelle nicht. Dieser Anstieg ist ein gutes Zeichen, denn wenn wir uns ehrlich machen: Noch immer wissen viele Menschen überhaupt nicht, dass es diese Stelle gibt. Ich hatte auch schon zum ersten Jahresbericht hier vorgetragen, Vertrauen aufzubauen, ist wirklich eine Daueraufgabe. Wir sehen aber, dass diese Arbeit, die Sie machen, auch Früchte trägt. Sie fördern gezielt Öffentlichkeitsarbeit, sprechen gezielt Akteure an und bieten auch mehrsprachige Angebote an und bauen sie aus. Das führt dazu, dass es mehr Fälle werden, oder besser gesagt, es bringt mehr Vorfälle ans Licht. Es sind oftmals so kleine Fragen der Gerechtigkeit, die aber für Betroffene die ganze Welt bedeuten. Auch das, was für uns hier vielleicht manchmal so selbstverständlich sein mag, ist für andere einfach ein unüberschaubares Dickicht der Bürokratie. In diesem Sinne möchte ich, der auch selbst mal Verwaltungswissenschaften studiert hat, ausdrücklich betonen und hervorheben: Jetzt auch noch Beschwerden bearbeiten, das klingt ja nach noch mehr Bürokratie, Herr Dregger hat es auch gerade gesagt, aber glücklicherweise lese ich aus dem Bericht einen ganz anderen Verwaltungsgeist. In den Verfahrensgrundsätzen wird geschrieben, und ich zitiere, weil ich es selbst nicht besser hätte sagen können:
„Es gilt, Probleme der Beschwerdeführenden zu lösen und nicht „Akten zu füllen“. Ich finde, an dieser Einstellung könnten wir uns alle ganz grundsätzlich auch ein Vorbild nehmen.
[Beifall bei den GRÜNEN –Beifall von Niklas Schrader (LINKE)]
Blicken wir auf die Inhalte des diesjährigen Berichts! Betroffen sind Menschen aus der ganzen Stadt, Sachverhalte aus allen Bezirken, beim LABO, LAGeSo, bei den Jobcentern und leider besonders oft beim Landesamt für Einwanderung. Da knirscht es besonders häufig, weil Verfahren nicht schnell oder sehr bürokratisch bearbeitet werden. Ich möchte dabei auch betonen, eine böse Absicht ist eigentlich nicht die Regel, sondern die absolute Ausnahme. Das zeigt aber auch: Gerade wenn die Belastung in den Behörden hoch ist, erschwert das gerechtes Verwaltungshandeln. Wem kann man es dann verübeln, sich zu beschweren, wenn Bürokratie einem das Leben schwer macht? – Da danke ich natürlich dem Beauftragten, wenn er im Einzelfall vermitteln kann, dass der Arbeitsplatz wegen überlangen Bearbeitungszeiten für den Aufenthaltstitel doch nicht verloren geht, aber noch besser wäre es doch, wenn das LEA so aufgestellt wäre, dass Verfahren schnell bearbeitet werden können, und solche Fälle gar nicht erst entstehen müssten. Nicht anders ist die Situation, Herr Oerke hat es genannt, in den Sozialämtern. Im Bericht beschreiben Sie diese als katastrophal. Das sind aus meiner Sicht für uns wichtige Arbeitsaufträge aus diesem Jahresbericht – ich hoffe doch, auch für die zuständigen Senatorinnen und Senatoren.
Besonders interessiert blicke ich dann noch als Innenpolitiker vor allem auf die Fälle der Berliner Polizei. Es ist auch wenig überraschend, dass die Polizei als ausführender Arm des Gewaltmonopols auch immer etwas Stoff für Konflikte bietet. Ich finde es gut und richtig, wenn Aufarbeitung stattfindet, sei es beispielsweise bei dem falschen Vorwurf des Besitzes der Kinderpornografie im Zusammenhang mit einer Hausdurchsuchung wegen ein paar Cannabispflanzen, genauso wenn einem Schüler von der Polizei ein Strafverfahren aufgrund eines Hitlerbildes in einem Klassenchat droht, obwohl dieser nicht einmal ein Smartphone besitzt und es gar nicht gewesen sein kann, oder wenn ein Polizist aus Eigeninteresse als Vorsitzender einer Kleingartenkolonie seiner Parzellennachbarin Anzeigen aufhalst, um der Betroffenen mal ihre Grenzen aufzuzeigen. Transparenz bedeutet in all diesen Fällen auch bei Fehlverhalten, dass anerkannt wird, was passiert, dass benannt wird, was passiert, und dass es reflektiert wird. Wer nicht aus Fehlern lernt, der verspielt Vertrauen und nimmt sich vielleicht auch manchmal selbst die Chance, es besser zu machen. Manchmal gelingt das dem Beauftragten dabei sogar besser als uns in unseren politischen Debatten, wenn zum Beispiel selbst Betroffene der Letzten Generation im Gespräch mit der Polizei zwar keine Einigkeit, aber zumindest einen positiven Dialog und mehr gegenseitiges Verständnis füreinander erlangen. Kurzum, ich komme zu dem Schluss: Die Schaffung des unabhängigen Beauftragten hat sich zweifellos als richtige Entscheidung erwiesen, und ich hoffe, dass sich zukünftig auch weitere strukturelle Veränderungen ergeben, beispielsweise bei der Anpassung von polizeiinternen Abläufen, Einsatzstrategien, aber auch der Stärkung des Polizeibeauftragten als Institution unabhängiger Kontrolle. Ich finde, wir sind dabei auf dem richtigen Weg. Ich bin gespannt auf den nächstjährigen Bericht.
Ich möchte abschließend noch dazu beitragen, etwas Misstrauen abzubauen. Lieber Herr Kollege Dregger und meine Herren von der CDU! Ich weiß, Sie zweifeln immer noch an diesem unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten und daran, dass es ihn braucht. Ich bin auch der Annahme, dass Sie mir jetzt aus Prinzip schon nicht glauben wollen. Daher lege ich Ihnen allen den Kommentar zum Jahresbericht von einer Landeskorrespondentin der B.Z. ans Herz. Sie sagt:
„Nach der Lektüre seines jüngsten Jahresberichtes denke ich: Gut, dass es ihn … gibt. Etliche Bürger würden sonst wohl nicht zu ihrem Recht kommen.“
Also wenn es mittlerweile selbst in der B.Z. steht, Herr Kollege Dregger, dann besteht noch Hoffnung, dass auch Sie noch überzeugt werden. In diesem Sinne wünsche ich gerade den Mitgliedern der CDU-Fraktion gute Lektüre und freue mich, dass es nächstes Jahr noch besser wird und weitergeht. – Vielen, Dank!